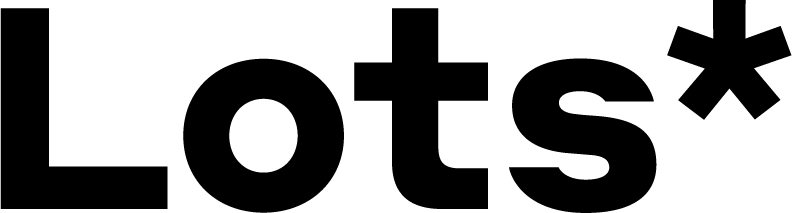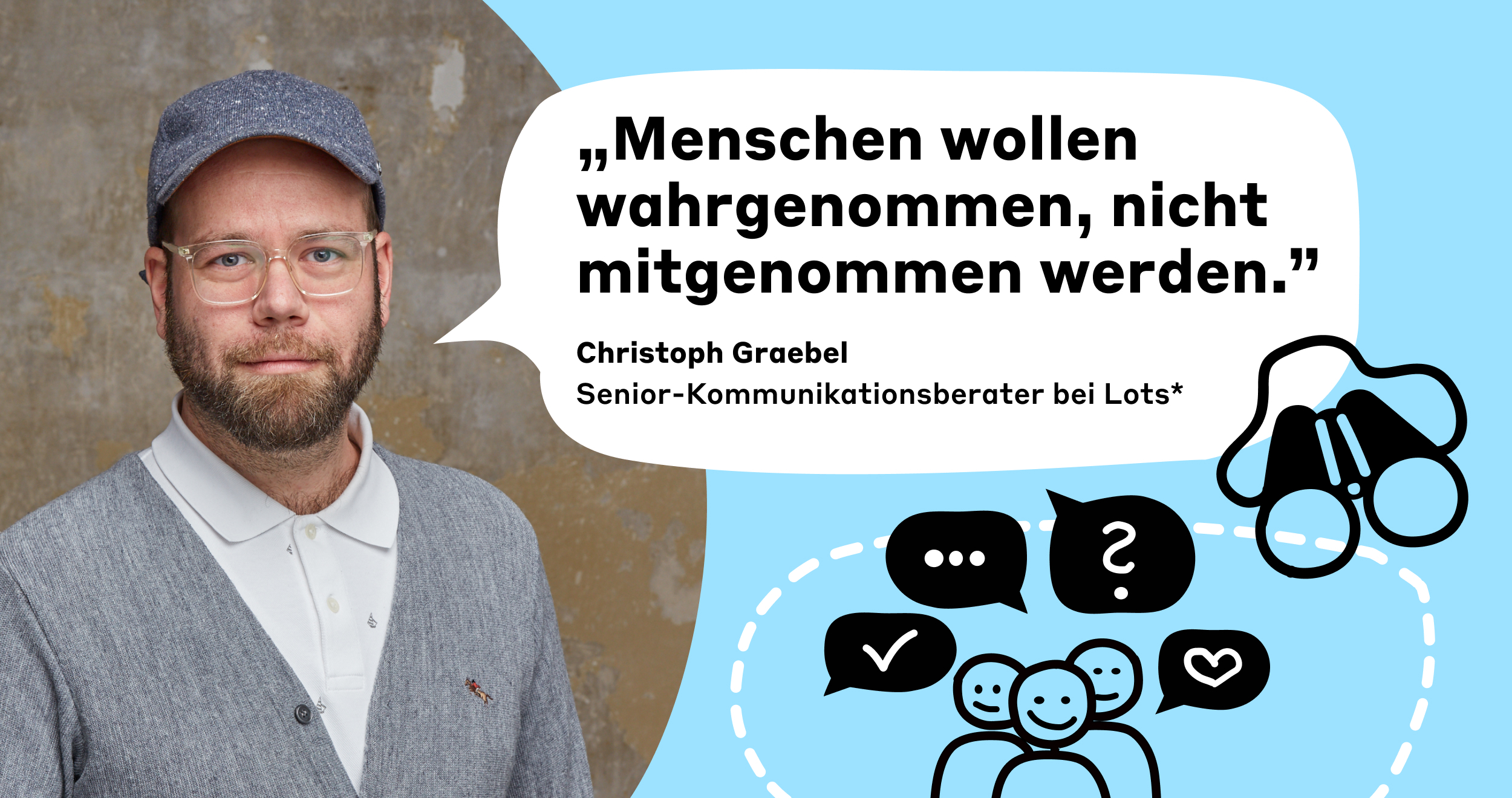Als ich vor zweieinhalb Jahren die Kommunikationsbegleitung für das Planungsprojekt 6-streifige Erweiterung der A 3 westlich von Regensburg übernahm, war die Ausgangslage eindeutig unklar: mehrere Jahre Planungszeit für 13 Kilometer in die Jahre gekommene Fahrbahnen inkl. Ersatzneubau von 17 Brücken, darunter die 930 Meter lange Donaubrücke Sinzing. Letztere in einem Zustand, der die Planungszeit unter Umständen nicht überlebt.
Mit der guten Nachricht, dass es eine neue Brücke geben wird, musste also auch die schlechte verbreitet werden, dass die alte Brücke über ein Jahr lang aufwendig instandgesetzt werden muss, damit sie so lange hält, bis die neue Brücke steht. Es ging längst nicht mehr um klassische Baustelleninformation – es ging um Deutungshoheit.
Das Problem: Wenn marode nicht marode bedeutet
Aktuell steht Deutschland steht vor einem enormen Brückensanierungsstau. Über 4.000 Brücken gelten als marode. Doch was bedeutet marode eigentlich? Ein Brückenbauwerk mit schlechter Zustandsnote ist nicht automatisch einsturzgefährdet – möglicherweise wurde nur das Geländer seit 15 Jahren nicht lackiert. Das kann sich auf die öffentlich einsehbaren, aber dort nicht erläuterten Zustandsnoten auswirken.
Die eigentliche Herausforderung: Die meisten deutschen Straßenbrücken entstanden in den 1960er und 70er Jahren. Sie sind zeitgleich sanierungsbedürftig, weil sie gleich alt sind und für eine andere Verkehrsbelastungen konzipiert wurden. Die kommunikative Nagelprobe: Warum hat man nicht schon vor 20 Jahren präventiv saniert? Die Antwort ist ernüchternd. Vor 25 Jahren eine noch funktionstüchtige Brücke zu sanieren, weil sie in 20 Jahren nicht mehr tragfähig ist, hätte kommunikativ sehr eng begleitet werden müssen.
Diese Ausgangslage zeigt: Erfolgreiche Brückenkommunikation braucht eine durchdachte Strategie. Sie muss technische Details ebenso berücksichtigen wie emotionale Ängste der Betroffenen. Dabei folge ich in meiner Arbeit dem Grundsatz „von innen nach außen kommunizieren“ – nur wenn die internen Informationsflüsse zwischen den Planungs- bzw. Bauteam und den Kommunikator*innen einwandfrei funktionieren, kann die Kommunikation nach außen den gewünschten Effekt bringen.
Aus meiner jahrelangen Erfahrung mit Infrastrukturprojekten habe ich drei zentrale Erkenntnisse gewonnen:
1. Menschen wollen wahrgenommen, nicht mitgenommen werden
Der klassische Kommunikationsansatz „Wir holen die Bürger*innen ab und nehmen sie mit" greift zu kurz. Anwohner*innen wollen spüren, dass ich als Projektverantwortlicher weiß: Diese Menschen wohnen hier. Diese Baumaschine geht denen auf die Nerven. Diese Vollsperrung beeinträchtigt deren Arbeitsweg.
Konkret bedeutet das: Ich muss die Anwohnerin als Expertin für ihr Umfeld ernst nehmen. Sie kann mir erklären, welche Auswirkungen eine nächtliche Sperrung hat. Ich kann ihr nicht erklären, warum sie an die Autobahn gezogen ist – aber ich kann ihre Expertise über ihr Lebensumfeld anerkennen.
2. Perspektivwechsel als Erfolgsfaktor
Erfolgreiche Baukommunikation erfordert multiperspektivisches Denken. Ich muss die Zwänge der Bauleute verstehen. Die Planungslogik der Ingenieur*innen nachvollziehen. Die Auswirkungen auf Busverkehr berücksichtigen – auch im ländlichen Raum, wo „hier fährt ja kein Bus" schnell gesagt, aber manchmal eben auch ein bisschen falsch ist.
Entscheidend ist dabei ein wirksames Stakeholdermanagement, das mit einer umfassenden Umfeld- und Stakeholderanalyse zu Projektbeginn beginnt. Der eine Stakeholder muss seinen Schulbus wegen Staugefahr früher losfahren lassen, die andere Stakeholderin interessiert sich eher für die Radwege unterhalb der Brückenbaustelle, der dritte hat die Erreichbarkeit für Rettungskräfte im Blick, der vierte braucht frühzeitige Infos für seine 9000 Mitarbeitenden und der fünfte hat einen leichten Schlaf, weswegen “wir arbeiten rund um die Uhr” als positives Moment bei ihm nicht zählt. Der Perspektivwechsel hilft mir auch dabei, das gemeinsame Anliegen zu identifizieren: nicht die Brücke soll schnell fertig werden, sondern der Verkehr soll nicht zum Erliegen kommen.
3. Ehrlichkeit vor Transparenz
Die Menschen wollen nicht alle Dokumente aus meinem Rechner sehen, im Sinne der kommunikativ und politisch viel beschworenen Transparenz. Sie wollen ehrlich über das informiert werden, was sie interessiert und betrifft. Ehrliche Projektkommunikation bedeutet für mich: Ich muss nicht alles sagen, aber was ich sage, muss stimmen.
Diese Erkenntnis deckt sich mit einem wichtigen Prinzip: Das Projekt muss Fragen stellen und beantworten, bevor andere es tun. Fragestellende suchen sich Antworten zu ihren Fragen. Erhalten sie diese nicht direkt vom Projekt, besteht die Gefahr, dass Missverständnisse und Falschinformationen in Umlauf geraten.
Praktisch führt das zu einer Strategie, die zunächst paradox erscheint: Lieber Verschlechterungen ankündigen als Verharmlosungen. Wenn ich erhebliche Verkehrseinschränkungen ankündige, habe ich drei Effekte: Wer es wirklich schlimm findet, fühlt sich ernst genommen. Wer es nicht so schlimm findet, ist positiv überrascht. Und weniger Menschen fahren zu den kritischen Zeiten – was die tatsächlichen Auswirkungen reduziert.
Meine Checkliste für erfolgreiche Baukommunikation:
Strategische Grundlagen:
✓ Kommunikation als eigenständiges Arbeitspaket mit klaren Zuständigkeiten und ausreichenden Ressourcen verankern
✓ Bereits in der Planungsphase gemeinsam das Kommunikationsziel definieren
✓ Kontinuierliche und ehrliche Information an alle (politischen) Stakeholder*innen
Operative Umsetzung:
✓ Stakeholder*innen über gemeinsame Anliegen identifizieren
✓ Regionale Reichweite maximieren – wer nicht fahren kann, verursacht keinen Stau
✓ Informationswebsite als zentrale Plattform nutzen
Wie messe ich den Erfolg meiner Kommunikation?
Der Erfolg von Baukommunikation lässt sich nicht über Website-Zugriffe oder Social-Media-Reichweiten messen. Entscheidend sind die realen Auswirkungen auf das Projekt und die Beteiligten. Bei angekündigten Vollsperrungen schaue ich mir den Anteil regionaler Kennzeichen im Umfahrungsverkehr an. Wenn ich vor Ort bin und sehe, dass fast keine regionalen Kennzeichen mehr dabei sind, weiß ich: Die Information ist angekommen und die Menschen haben ihr Verhalten entsprechend angepasst.
Ein weiterer wichtiger Indikator ist die Medienberichterstattung. Wenn ich von Journalisten höre „so schlimm war es ja gar nicht", dann hat meine Kommunikation funktioniert. Das bedeutet: Die Erwartungen wurden richtig gesetzt, haben die Leute dazu veranlasst, ihr Verhalten anzupassen und die tatsächlichen Auswirkungen konnten so als weniger problematisch wahrgenommen werden als befürchtet. Langfristig zeigt sich der Kommunikationserfolg in Statements von Wirtschaftsverbänden oder anderen Stakeholder*innen, die sagen: „Wir haben immer alles rechtzeitig gewusst, wir konnten uns auf alles einstellen." Das ist der Beweis dafür, dass die Kommunikation ihre wichtigste Funktion erfüllt hat: Planungssicherheit und Vertrauen zu schaffen.
Spezialfall Brückenprojekte: Besondere Herausforderungen meistern
Straßenbaustellen – insbesondere bei Ausbau- oder Erhaltungsprojekten an Autobahnen – stellen eine besondere Herausforderung für die Kommunikation dar. Sie betreffen nicht nur die unmittelbare Umgebung, sondern oft ganze Regionen und tausende Verkehrsteilnehmer*innen täglich.
Bei Brückenprojekten kommt eine Besonderheit hinzu: Brücken sind immer Engstellen. Wenn ich eine Brücke abbreche, brauche ich immer eine Alternative. Das macht sie aufwendig in der Planung, im Bau, aber eben auch in der Kommunikation.
Meine Erfahrung zeigt: Wer Meilensteine im Bauverlauf als Ereignis inszeniert, kann sogar positive Aufmerksamkeit erzeugen. So können etwa beim Abriss von Brücken Besucherplattformen eingerichtet und das Ereignis als öffentliches Event kommuniziert werden. Dies schafft Verständnis für das Projekt und kann öffentliches Vertrauen in die Kompetenz des Projektteams entwickeln.
Infrastruktur als Kommunikationsaufgabe
Der Infrastruktursanierungsstau erfordert noch viele weitere Großbauprojekte. Nicht nur die planerischen und bautechnischen, auch die kommunikativen Herausforderungen werden mit der wachsenden Komplexität von Infrastrukturprojekten weiter steigen.
Meine wichtigste Lektion: Erfolgreiche Kommunikation ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von strategischem Wissensaufbau, Perspektivwechseln und kontinuierlicher Evaluation und Anpassung. Sie beginnt nicht mit dem ersten Spatenstich, sondern mit dem ersten Planungsgedanken. Und sie endet nicht mit der Einweihung, sondern erst, wenn alle Beteiligten sagen können: So schlimm war es ja gar nicht.