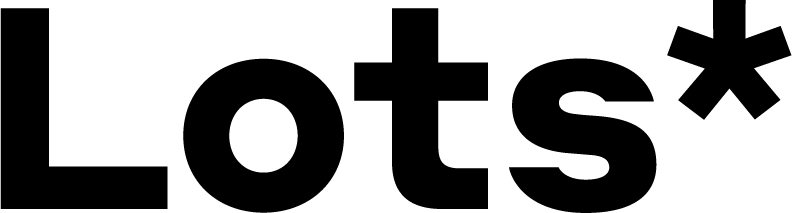CCS-Vorhaben stellen Projektteams vor eine besondere kommunikative Herausforderung: Eine hochkomplexe, weithin unbekannte Technologie muss verschiedensten Stakeholder*innen erklärt werden – von skeptischen Bürger*innen über Umweltverbände bis hin zu Kommunal-Politiker*innen. Ohne strategische Vorbereitung drohen Projektteams in solchen Gesprächen zwischen technischen Erläuterungen und emotionalen Vorwürfen wie „Das ist doch nur Greenwashing!" zu navigieren – ohne klare Botschaften und mit einer Vielzahl offener Fragestellungen. Ein klassisches Beispiel dafür, wie wichtig eine strategische Kommunikationsstrategie bei CCS-Projekten sein wird.
Was beschäftigt Kommunikationsverantwortliche von CCS-Projekten?
CCS steht für Carbon Capture and Storage – die Abscheidung und Speicherung von CO₂. Vereinfacht gesagt: CO₂ wird direkt an der Quelle „eingefangen“, noch bevor es in die Atmosphäre gelangt, transportiert und in tiefen geologischen Schichten dauerhaft gespeichert.
Am 6. August 2025 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) beschlossen. Damit wird erstmals die dauerhafte Speicherung von CO₂ in Deutschland nicht nur zu Forschungszwecken, sondern auch im industriellen Maßstab möglich. Die Novelle schafft die rechtliche Grundlage für Branchen wie die Zement- und Kalkindustrie, die Stahlerzeugung, die Grundstoffchemie und die Abfallverbrennung, um klimaneutral zu wirtschaften – Bereiche, in denen sich CO₂-Emissionen nicht vollständig vermeiden lassen.
Für Kommunikationsabteilungen bedeutet das: Sie müssen sich auf neues Terrain begeben. Anders als bei etablierten Energietechnologien gibt es noch keine bewährten Kommunikationsstrategien. Stattdessen kreisen die Diskussionen um grundlegende Fragen:
Timing: Zu welchem Zeitpunkt sollte ich mit einem CCS-Projekt an die Öffentlichkeit gehen – zu früh und es entstehen unnötige Widerstände, weil zu einem frühen Projektstand noch nicht alle Details feststehen – zu spät und ich verliere das Vertrauen?
Interne Expertise: Wie baue ich das nötige Fachwissen n meinem Team auf, ohne dass wir uns in technischen Details verlieren?
Stakeholder*innen-Management: Wer sind meine relevanten Stakeholder*innen und wie stehen sie zu CCS? Wie gehe ich proaktiv auf verschiedene Interessensgruppen zu, ohne dass es wie Lobbying wirkt?
Medienarbeit: Wie kommuniziere ich proaktiv mit lokalen Medien, bevor negative Berichterstattung entsteht?
Warum ist CCS-Kommunikation so komplex?
CCS ist keine alltägliche Technologie wie Solar- oder Windkraft. Die Chemie-, Zement- oder Stahlindustrie stehen dabei besonders im Fokus. Bei der Stahlherstellung entstehen z.B. rund zwei Drittel der CO₂-Emissionen prozessbedingt durch die chemische Umwandlung von Kalk/Kalkstein – sie sind schlicht unvermeidbar. Für Unternehmen der Stahlindustrie ist CCS daher keine Option, sondern Notwendigkeit für das Erreichen der Klimaziele bis 2030.
Doch genau hier beginnt das kommunikative Dilemma: Wie erklärt man einer skeptischen Öffentlichkeit eine Technologie, die komplex, unsichtbar und für viele Menschen (in der Regel völlig) neu ist?
Drei zentrale Kommunikations-Knackpunkte
Aus unserer Beratungspraxis mit Industrieunternehmen sehen wir drei wiederkehrende Herausforderungen:
Das Sicherheits-Paradox „Wie antworte ich auf die Frage nach Leckagen, ohne dass es wie Beschwichtigung klingt?“ CCS-Skeptiker*innen formulieren konkrete Ängste: Leckagen, Grundwasserverunreinigung, Erdbeben. Die Antwort der Unternehmen folgt oft dem Muster: „Das ist sicher, weil...“, aber reine Fakten überzeugen nicht, wenn die Sorgen emotional sind. Stattdessen braucht es einen anderen Ansatz: Von der konkreten Sorge zur nachvollziehbaren Lösung.
Die Glaubwürdigkeitslücke „Wie begründe ich intern, dass wir Millionen in eine Technologie investieren, die viele als Greenwashing sehen?“ Dieser Vorwurf trifft viele Unternehmen unvorbereitet. Hier reicht es nicht, die technische Notwendigkeit zu erklären. Es braucht eine glaubwürdige Einordnung: Warum ist CCS echter Klimaschutz und notwendig?
Die Komplexitätsfalle „Wie erkläre ich geologische Speicherung, ohne dass alle nach fünf Minuten abschalten?" Geologische Formationen, Deckschichten, Monitoring – die CCS-Kommunikation droht in Fachjargon zu versanden. Gleichzeitig sind Vereinfachungen riskant, weil sie Angriffsflächen für Kritik bieten.
Unser Ansatz: Das strategische Argumentarium
In unserer Projektarbeit entwickeln wir gemeinsam mit Unternehmen systematische Argumentarien – strukturierte Werkzeuge für die CCS-Kommunikation. Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie können wir Unsicherheiten und Widerstände frühzeitig erkennen, souverän darauf reagieren und die Akzeptanz für das Projekt stärken? Das Prinzip: Nicht reaktiv auf Kritik antworten, sondern proaktiv Botschaften entwickeln. Dabei gehen wir wie folgt vor:
Schritt 1: Kritikpunkte systematisch sammeln
Wir analysieren kritische Fragen aus Medienberichten und Umweltverbandspapieren. Das Ergebnis: Ein Katalog von Gegenargumenten, der von Sicherheitsbedenken über Wirtschaftlichkeit bis hin zu Transparenzkritik reichte.
Schritt 2: Die Drei-Ebenen-Struktur
Für jeden Kritikpunkt entwickelten wir drei Antwortebenen:
- Vorwurf: Die konkrete Kritik in ihrer schärfsten Form
- Argumentation: Die fachliche Widerlegung mit Belegen
- Antwort: Die verständliche, authentische Kommunikation nach außen
Schritt 3: Lokale Anpassung
Ein Argumentarium muss standortspezifisch sein. Die lokalen Gegebenheiten bei einem Vorhaben in Sachsen unterscheiden sich von denen in Bayern. Entsprechend variierten die Botschaften.
Schritt 4: Interne Schulung
„Wie stelle ich sicher, dass mein*e Vertriebsleiter*in dieselben Botschaften verwendet wie unser*e Pressesprecher*in?“ Das Argumentarium funktioniert nur, wenn alle relevanten Mitarbeitenden geschult sind – von Geschäftsführer*in bis zur Empfangskraft.
Praxisbeispiel: Vom Vorwurf zur Botschaft
Nehmen wir einen klassischen Kritikpunkt: „CCS gefährden das Grundwasser.“ Ohne Argumentarium lautet die typische Antwort: „Das ist technisch ausgeschlossen, weil wir in 2.000 Meter Tiefe speichern.“
Mit Argumentarium wird daraus: „Diese Sorge nehmen wir ernst. Deshalb nutzen wir die geologischen Formationen, die durch natürliche Barrieren vom Grundwasser getrennt sind – wie ein wasserdichter Tresor tief unter der Erde. Zusätzlich überwachen wir den Speicher kontinuierlich, genau wie bei der bewährten Erdgasspeicherung, die seit 70 Jahren sicher funktioniert.“
Der Unterschied: Statt technischer Abwehr eine empathische, verständliche Erklärung mit konkreten Vergleichen.
Herausforderungen im Projektverlauf
„Was mache ich, wenn später auf der Bürger*innen-Versammlung plötzlich jemand Fragen stellt, die nicht in unserem Argumentarium stehen?“ Diese Sorge beschäftigt viele Kommunikationsverantwortliche. Unsere Erfahrung: Ein gutes Argumentarium deckt 80-90 Prozent der kritischen Fragen ab. Für den Rest braucht es:
- Klare Eskalationswege: Wer kann welche Fragen beantworten?
- Transparente Grenzen: „Das können wir heute nicht beantworten, aber wir holen die Information nach.“
- Kontinuierliche Updates: Jede neue Frage fließt in die nächste Version des Argumentariums ein.
Fazit
CCS-Kommunikation ist mehr als technische Aufklärung – sie ist Vertrauensarbeit. In einer Zeit, in der viele Infrastrukturprojekte an mangelnder Akzeptanz scheitern, können sich Unternehmen einen improvisierten Auftritt nicht mehr leisten. Die Technologie mag komplex sein, aber die Kommunikation darüber muss es nicht sein.
Ein strategisches Argumentarium schafft die Grundlage für zielgruppengerechte Kommunikation. Es verwandelt defensive Reaktionen in proaktive Botschaften und emotionale Ängste in sachliche Diskussionen. Vor allem aber gibt es Kommunikationsverantwortlichen das Werkzeug an die Hand, das sie brauchen: Orientierung in einem hochkomplexen Themenfeld.
Die CCS-Debatte wird weiter an Intensität gewinnen. Unternehmen, die jetzt in professionelle Kommunikationsvorbereitung investieren, schaffen nicht nur die Basis für erfolgreiche Projekte – sie leisten einen entscheidenden Beitrag dafür, dass die notwendige Transformation der Industrie gelingt. Denn am Ende entscheidet nicht die beste Technologie, sondern die beste Kommunikation über den Erfolg.