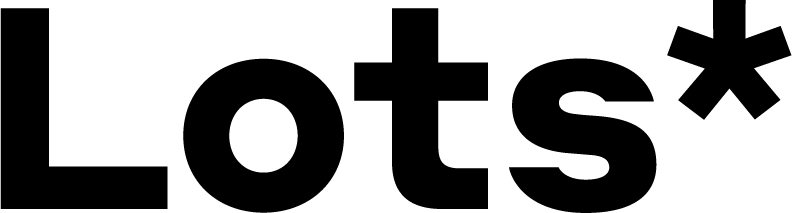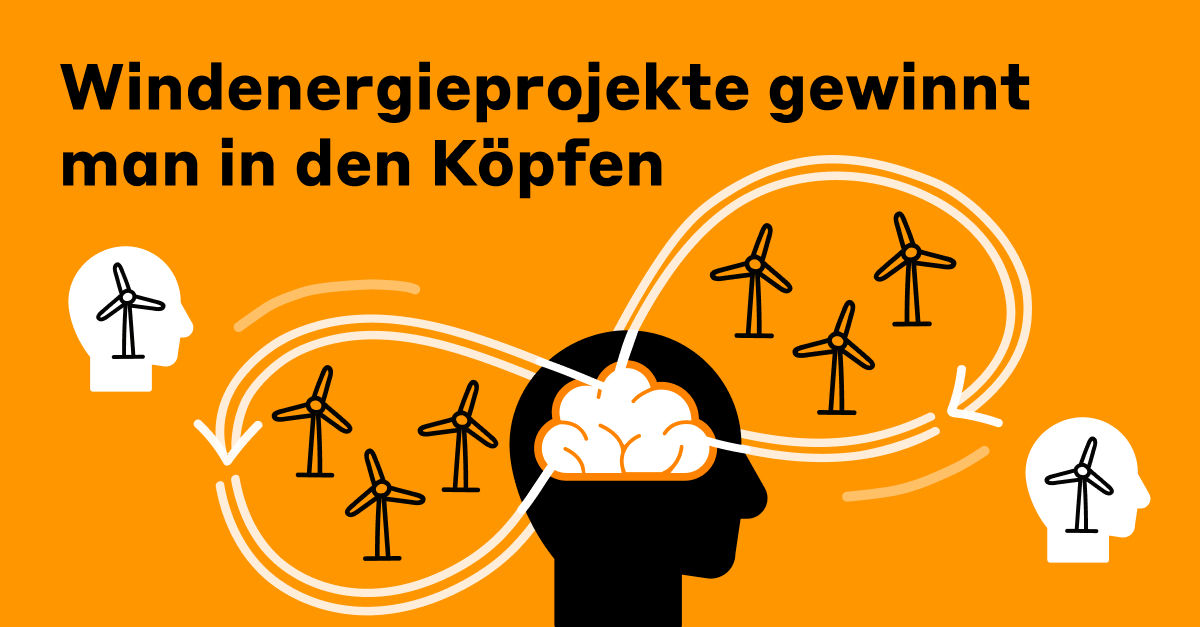Die Energiewende beschleunigt sich, Genehmigungsfristen für Windparks werden kürzer, Kommunen müssen intensiver beteiligt werden. Damit steigt der Druck auf Projektentwickler*innen, ihre Kommunikation vor Ort professioneller, gezielter und vor allem glaubwürdiger zu gestalten. Denn ohne Akzeptanz in den Gemeinden, in denen Windparks entstehen, lässt sich kein Projekt langfristig umsetzen.
Lots* begleitet seit Jahren Projektträger*innen dabei, wie sie Windparks in Gemeinden anstoßen und die öffentliche Diskussion steuern. Doch wie kann das gelingen? Aus unserer Erfahrung gibt es einige einfache, aber entscheidende Regeln, die darüber entscheiden – über Zustimmung oder Ablehnung.
1. Von Anfang an: Strategie erst nach Analyse entwickeln
Bevor Sie einen Maßnahmenplan schreiben, sollten Sie die Stakeholder*innen und ihre Haltungen genau kennen. Dafür genügt keine reine Recherche vom Schreibtisch aus. Wer ist klar dagegen? Wer könnte unterstützen? Erst wenn dieses Bild steht, macht es Sinn, in Maßnahmen zu investieren. Planen Sie regelmäßige Treffen mit allen Gruppen – auch mit Kritiker*innen. Der sichtbare, sachliche Austausch wirkt oft stärker als jede Hochglanzbroschüre.
2. In kleinen Schritten arbeiten
Widerstände lösen sich selten mit einem großen Schlag. Viel wichtiger ist es, in kleinen Schritten Vertrauen aufzubauen und im Detail nach den Türen zu suchen, die sich öffnen lassen. Das setzt Vertrauen in eine iterative Strategie voraus: Nicht alles muss sofort gelingen, entscheidend ist die Richtung. Im Vogtland etwa stößt der Ausbau der Windenergie im Wald auf Widerstand mehrerer Bürger*innen-Initiativen. Einzelne Kritikpunkte lassen sich zwar mit Argumenten und Fakten entkräften, doch je größer und vernetzter der Widerstandskern wird, desto schwieriger ist es, diesem und Fehlinformationen etwas entgegenzusetzen. Kommunikation kann in solchen Situationen nur noch begrenzt wirken. Was bleibt, ist eine kleinteilige, sehr konkrete Beratung vor Ort, die auf die Sorgen der Menschen eingeht und Transparenz schafft – großflächige Maßnahmen stoßen dagegen schnell an ihre Grenzen.
3. Nicht an Gegenwind abarbeiten
Wer grundsätzlich gegen Windkraft ist, lässt sich selten umstimmen. Besser ist es, die Energie in die potenziellen Multiplikator*innen zu investieren. Gerade in Phasen lauter und hitziger Gegenstimmen vergessen Projektleitungen oft, dass es auch sachliche und positive Stimmen gibt – und diese brauchen gezielte Stärkung.
4. Lokale Anknüpfungspunkte nutzen
Oft entsteht Akzeptanz, wenn Windparks sichtbar zur Lebensqualität beitragen. Das kann die Förderung des örtlichen Sportvereins sein, die Modernisierung eines Gemeindehauses oder Unterstützung für Kulturprojekte. Solche konkreten, vor Ort sichtbaren Maßnahmen erzeugen Bindung und Sympathie. Wichtig ist: Sie müssen nachvollziehbar kommuniziert werden – so werden sie nicht als „Bestechung“ betitelt, sondern als Partnerschaft anerkannt.
5. Präsenz zeigen
Glaubwürdigkeit entsteht nicht am Schreibtisch. Projektleitende müssen regelmäßig vor Ort sein, Gesprächsrunden besuchen und die Gegebenheiten persönlich kennen. Wer nur aus der Distanz agiert, verliert schnell Vertrauen. Auch auf regionale Besonderheiten sollte man eingehen – ob durch die Einbindung lokaler Minderheitensprachen oder durch Rücksichtnahme auf Traditionen.
6. Multiplikatoren mit Glaubwürdigkeit gewinnen
Menschen vertrauen in der Regel nicht der Politik oder anonymen Konzernen, sondern lokalen Playern: dem Sportverein, der Handwerkskammer, dem mittelständischen Betrieb als Arbeitgeber. Identifizieren Sie diese Stimmen frühzeitig und machen Sie sie zu Partnern. Sie können für Ihr Projekt sprechen und somit die Glaubwürdigkeit stärken.
7. Lösungen vor Ort suchen
In jeder Gemeinde gibt es Einrichtungen, die stark in die Gesellschaft hineinwirken – Umweltzentren, Ortsräte, Initiativen. Laden Sie dorthin Expert*innen ein, die Mythen entkräften und mit Fakten überzeugen. Entscheidend ist: Die Stimme muss lokal verankert und fachlich solide sein.
8. Iterative Baukommunikation um Prozesse transparent zu machen
In der Bauphase beispielsweise bedeutet die projektbezogenen Kommunikation vor allem auch die enge Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen. Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass meist kein verbindlicher Detail-Bauplan mit festen Zwischenschritten vorliegt, sondern häufig lediglich das Enddatum feststeht. Das erschwert die Abstimmung und Kommunikationsplanung erheblich, da Abläufe flexibel angepasst und dennoch zuverlässig koordiniert werden müssen.
Was Gemeinden gewinnen können
Dass Windparks eine echte Chance für Gemeinden sind, zeigen viele Beispiele. Kommunen profitieren inzwischen verpflichtend mit mindestens 0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde. Bei größeren Parks summieren sich die Einnahmen auf mehrere Hunderttausend Euro jährlich. Dieses Geld kann gezielt in die Gemeindeentwicklung fließen – etwa in Sportstätten, Begegnungsräume oder Infrastruktur.
In der Lausitz entsteht bei Schöps das höchste Windrad der Welt: 365 Meter hoch, fast so groß wie der Berliner Fernsehturm. Es ist Teil eines 160-Millionen-Euro-Projekts mit sechs Anlagen, liefert seit 2025 Strom für 57.000 Menschen. Für die Anwohner*innen bedeutet das nicht nur sauberen Strom aus der Region, sondern auch neue Aufträge für lokale Unternehmen und zusätzliche Steuereinnahmen für die Kommune.
Und an dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf eine bewährte Beteiligungsidee. Große Energiekonzerne erzielen über Stromerlöse erhebliche Gewinne. Energiegenossenschaften kämpfen hingegen mit steigenden Pachtpreisen und dem Ausschreibungssystem. Doch auch hier kann gute Kommunikation helfen: Indem Bürger*innen frühzeitig beteiligt und über Genossenschaftsmodelle eingebunden werden, entsteht wieder Nähe und Identifikation.
Fazit
Die Kommunikation rund um Windparks ist heute mehr als reine Informationsarbeit. Sie ist Beziehungsmanagement. Erfolgreiche Projektentwickler*innen begreifen sich nicht als externe Akteur*innen, die etwas „auf die Gemeinde“ bringen, sondern als Partner, die gemeinsam mit der Kommune Lösungen entwickeln.
Wer die oben genannten Regeln beachtet – Stakeholder*innen- und Umfeld-Analyse vor Maßnahmen, iterative Schritte in kritischen Gebieten, Multiplikator*innen vor Ort stärken, lokale Lösungen ermöglichen – schafft nicht nur Akzeptanz, sondern bringt die Energiewende gemeinsam mit den Menschen voran.